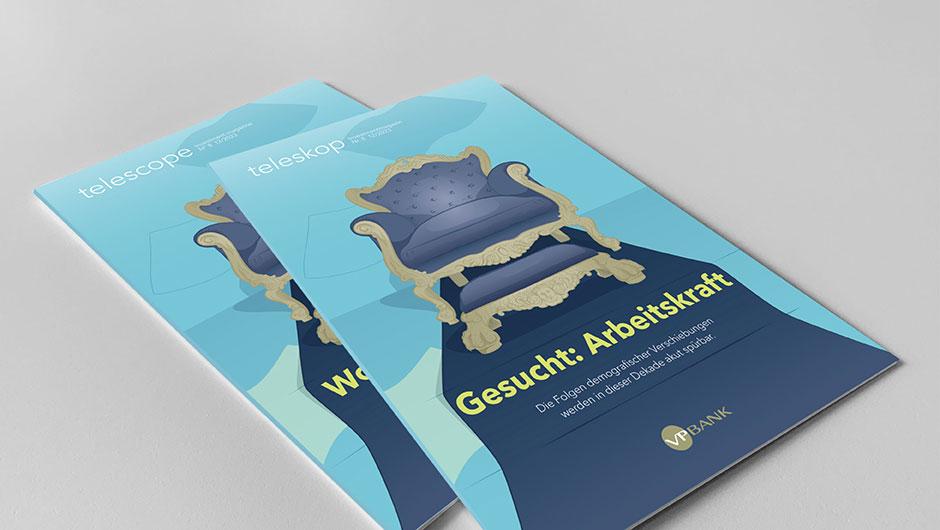Wie Unternehmen auf Strafzölle reagieren
Beispiel Waschmaschinen
Wie Unternehmen reagieren, zeigt die Einführung von US-Schutzzöllen Anfang 2018 auf Waschmaschinen-Importe exemplarisch. Seit 2013 waren Waschmaschinen günstiger geworden, was Konsumenten freute, aber nicht die US-Hersteller. Die neuen Zölle erfreuten die US-Hersteller wie Whirlpool, der direkt 200 neue Mitarbeiter einstellte. Ein Jahr später zeigt sich, dass die Preise für Waschmaschinen in den USA im Durchschnitt um 12 Prozent angestiegen und gleichzeitig weniger Geräte verkauft worden sind.
Flexible Reaktion
In- und ausländische Unternehmen reagieren unterschiedlich auf neue Handelsrestriktionen. Sicher ist, dass die Zölle an die Konsumenten weitergegeben werden. Im Beispiel der Waschmaschinen flossen die Kosten 1:1 weiter. Die inländischen Unternehmen erhöhten gleichzeitig ihre Preise. Selbst wenn sich der US-Präsident brüstet, wieviel Geld sein Land wegen der Zölle eingenommen hat: Unter dem Strich haben die Konsumenten die Zeche bezahlt. Im konkreten Fall der Waschmaschinen wurden die US-Haushalte bis Ende 2018 mit USD 1.5 Mrd. belastet.
Gleichzeitig haben die weltweit aktiven Unternehmen ihre Herstellprozesse angepasst. Die beiden südkoreanischen Waschmaschinenhersteller LG und Samsung etwa, die in China produzierten und die Geräte von dort aus in die USA verfrachteten, verschoben Teile der Produktion – nach Amerika. Sie schufen 2‘000 Arbeitsplätze und partizipieren nun auch selbst an den höheren Verkaufspreisen. Ähnlich agierte der bedeutendste Zulieferer des Smartphoneherstellers Apple, Foxconn. Er verlagerte Produktionskapazitäten von China nach Vietnam und vermied Nachteile. Solche Verlagerungen bedeuten, dass sich das Handelsdefizit der USA nicht verringert, sondern nur verlagert.
Wachstumstreiber Technologie
Gerade Technologieunternehmen sind von den derzeitigen Einschränkungen besonders betroffen. Denn Technologie ist sowohl für China als auch für die USA zentral für das künftige Wachstum. Das zeigt das Beispiel Huawei. Der chinesische Konzern ist der Marktführer bezüglich 5G-Mobilkommunikation sowie drittgrösster Smartphone-Verkäufer der Welt. Unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit belegen die USA das Unternehmen mit Handelsrestriktionen. Als grösster Einzelabnehmer von Halbleitertechnologie lösen die Sanktionen auch bei US-Zulieferern – vom Betriebssystemhersteller Alphabet (Google) bis zum Chipproduzenten Qualcomm ‑ Bauchschmerzen aus. Und es stehen bereits weitere Unternehmen im Fokus, die mit spezifischen US-Sanktionen rechnen müssen.
Für Anleger eröffnen sich Chancen
Die unsichere Situation über das sino-amerikanische Handelsverhältnis belastet die Börsen. Es herrscht Unklarheit darüber, wie sehr sich Umsatzausfälle, sinkende Margen oder höhere Kosten bei Unternehmen niederschlagen. Heftigere Kursausschläge bei betroffenen Unternehmen sollten deshalb einkalkuliert werden. Stark betroffene Sektoren sind Technologie, Automobil und Consumerelektronik.
Kurzfristige Effekte
Die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen lässt darauf schliessen, dass die Beeinträchtigungen temporär sind. Die Auswirkung an den Börsen kann signifikant sein, eröffnet dabei jedoch für langfristige Investoren Kaufchancen. Die Verschiebungen der Produktions- und Handelsströme kosten zwar, beeinträchtigen jedoch die künftige Wertschöpfung wichtiger Industrietrends nicht.
Finanzmarktkommentar von
Harald Brandl
Senior Investment Strategist